14.02.25
Die Mandelkern-Kolumne / Folge 9
Hier irrte Luhmann
Luhmann? Ist das eine KI? Nein. Niklas Luhmann war ein bedeutender Soziologe, der leider schon 1998 mit knapp 71 Jahren gestorben ist. Aber seine Theorie, dass nur die Kommunikation kommuniziert, gewinnt im Lichte der KI eine ganz neue Aktualität. Meine Kritik daran, auch schon über 12 Jahre alt, ist dagegen vielleicht nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Womöglich trotzdem bedenkenswert.

Na klar: Irrtum ist ein großes Wort. Und wenn man Aufsehen erregen will, muss man einen Großen anrempeln. Es gibt nichts Besseres. Siehe Peter Handkes Krawall bei der Gruppe 47. Irrtum ist aber auch ein fragwürdiges Wort. Zumindest, wenn man es wie ich mit den Systemtheoretikern hält. Dann kann es nämlich, statt nach richtig oder falsch zu unterscheiden, klüger sein zu fragen: Welche Ansicht führt zu welcher Lösung? (In einer Formulierung des Frankfurter Psychologen Walter Schwertl.) Gerade dem großen Pragmatiker Niklas Luhmann wird ein solches Herangehen gerecht.
So fragen wir denn: Zu welchen Lösungen führt seine Ansicht, dass nur die Kommunikation kommuniziert? Luhmanns Antwort: In der Kommunikation wird nichts übertragen. Genau diese Lösung finde ich höchst problematisch, weil sie nichts löst. Wohl widerspricht sie scharfsinnig Jürgen Habermas’ handlungstheoretisch begründetem Verständnis von Kommunikation, wonach diese vor allem auf Verständigung und Konsens abzielt. Demgegenüber findet Luhmann: „Es wird nichts übertragen. Es wird Redundanz erzeugt in dem Sinne, dass die Kommunikation ein Gedächtnis erzeugt, das von vielen auf sehr verschiedene Weise in Anspruch genommen werden kann.“
Redundanz und black box
Nun bedeutet der Begriff ‚Redundanz’ im Kontext der Kybernetik, aus der er hier entlehnt ist, soviel wie: Muster – oder eben: Kontext. Gregory Bateson benutzte als weiteres Synonym gerne auch das deutsche Wort ‚Gestalt’. Sie alle sind mehr oder weniger klangvolle Umschreibungen für eine Grundidee der Systemtheorie: Die beste Erklärung eines Systems ist das System selbst. Oder anders formuliert: Ein System ist eine Art black box. Immer nur begrenzt erklärbar. Wie Kants Ding an sich, das prinzipiell unerkennbare. Weil ein System so viele innere Strukturen und Verflechtungen von Zusammenhängen hat, von Ursachen und Wirkungen, die ihrerseits wieder auf andere Ursachen zurückwirken, dass sie ein einziges Knäuel rekursiver Beziehungen ergeben, welches wir niemals in Gänze entwirren und beschreiben können. Aber mit Mustern, die immerhin Anhaltspunkte für sein Verständnis liefern. (Das Wetter und die Mühen mit seiner langfristigen Vorhersage sind hierfür ein gutes Beispiel.)
So weit, so dunkel. Nur eines behauptet die Systemtheorie nicht: dass es keine Ursachen und Wirkungen gibt. Wenn es sie aber gibt, dann gibt es auch Übertragungen. Wie sonst könnte eine Ursache eine Wirkung erzeugen? Kurzum: Hier irrte Luhmann. Keine Redundanz ohne Übertragung. Was wird übertragen? Ansichten zum Beispiel. Das braucht in der Regel Argumente. Auch die müssen erst übertragen werden. Meist – und einmal mehr widerspreche ich Luhmann - geschieht dies nicht zweckfrei.
Schwupp di wupp: der Mensch ist weg
So werden häufig in der Kommunikation unterschiedliche Interessen verhandelt. Wenn in ihr nichts übertragen werden könnte, wären Kompromisse unmöglich. Womit wir beim Dreh- und Angelpunkt von Luhmanns Kommunikationsverständnis sind: Kompromisse, würde er sagen, sind Sache der psychischen Systeme, welche die Umwelt des kommunikativen Systems bilden. In anderen Worten: Menschen sind nicht Teil des Systems. Sie bestücken es nur. Da nur die Kommunikation kommuniziert, ist diese Bestückung – ja was eigentlich? Was tun Menschen, wenn sie sprechen oder schreiben, dies aber nicht „kommunizieren“ genannt werden darf? Sprechen ist etwas anderes als schreiben und beide sind etwas ganz anderes als denken, das hat Luhmann unnachahmlich beschrieben. Bateson spricht hier von der Codierung, derer jede Kommunikation bedarf. Aber begründet das ein eigenes System?
Das Spannende an Debatten über die Kommunikation ist doch die Frage, warum sie so oft scheitert – oder, wie die Systemtheoretiker sagen: Das Erstaunliche ist, wenn sie gelingt. Und zu dieser Frage kann Luhmann leider nichts beitragen. Denn nach seinem Verständnis ist die Kommunikation ein autopoietisches System, das sich per definitionem selbst erhält und unzerstörbar ist – zumindest, solange es psychische Systeme gibt und mit ihnen die Welt. Wohl kann es Kommunikationsabbruch geben, aber der muss eben auch kommuniziert werden – das System bleibt intakt. Toll. Und was haben wir damit? Ein Vater schlägt seine ganze Familie tot - Kommunikationsabbruch. Aber ins Gefängnis kommt er nur nach einer Gerichtsverhandlung – hurra, die Kommunikation ist wieder da.
Noch einmal: Die Entfernung der Menschen aus der Kommunikation löst das Problem der Kommunikation, indem es sie auflöst. Zurück bleiben drei formale Merkmale, die Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen, deren Bedeutung Luhmann weit überschätzt. Und er unterschätzt die Bedeutung des Bewusstseins, das aus seiner Sicht für die Kommunikation nur Rauschen ist. Besser gesagt, er kapituliert vor diesem „Irrwisch“, der „wie ein Irrlicht auf den Worten herum (tanzt)“. Der Beamte, der dann Soziologe wurde, mochte es ordentlich, und seine eigentümliche Theoriebautechnik war auf Begriffe aus, die es erlaubten, alles fein säuberlich in Schubladen zu verstauen. „Wir haben ein nicht mehr integrierbares Wissen über psychische und soziale Systeme.“ So beginnt sein berühmter Vortrag „Was ist Kommunikation?“, und er erläutert dies so: „In keinem der Fächer überblickt irgendein Forscher den gesamten Wissensstand; aber so viel ist klar, dass es sich in beiden Fällen um hochkomplexe, strukturierte Systeme handelt, deren Eigendynamik für jeden Beobachter intransparent und unregulierbar ist.“
Die Karte ist nicht das Territorium
Die spannende Frage ist nun: Meint er hier mit Systemen die Wissensdisziplinen Psychologie und Soziologie oder meint er das, was diese Disziplinen behandeln? Mein Verdacht ist, dass ihm dies durcheinandergeriet. Er beginnt mit der Karte und endet mit dem Territorium. Was letzteres angeht, also die menschliche Psyche oder die Gesellschaft, so organisieren sich diese „hochkomplexen und strukturierten Systeme“ selbst. Gerade das sagt die Theorie der Autopoiese, die sich Luhmann zu eigen gemacht hatte. Eine Regulierung durch einen Beobachter ist nicht vorgesehen, bestenfalls eine Beeinflussung – und die wird mit einem wachsenden Wissensstand eher leichter als schwerer. Und mit wachsendem Wissensstand nimmt die Intransparenz – gesellschaftlich gesehen – zwingend ab. Für den einzelnen Beobachter dagegen nimmt sie zu. Und der – nennen wir ihn einmal Herr Luhmann – hält sich den überfüllten Kopf und bezeichnet in seiner Not die Begriffe „Subjekt oder Individuum (…) nur als Leerformel für einen in sich hochkomplexen Tatbestand, der in den Zuständigkeitsbereich der Psychologie fällt und den Soziologen nicht weiter interessiert“.
So hätten wir dann zwar das Individuum aus dem Fach der Soziologie entfernt, nicht aber aus der realen Gesellschaft. Dort wimmelt es bekanntlich davon. Und bei dem Wunsch, erfolgreich miteinander zu kommunizieren, hilft all diesen Individuen – sagen wir ruhig: diesen Menschlein – die kühne Reduktion von Komplexität à la Luhmann wenig. Da ist eine andere Vereinfachung schon wesentlich nützlicher: Paul Watzlawicks geniale Unterscheidung von Inhalts- und Beziehungsebene. Sie lehrt uns, in der Kommunikation immer beides im Auge zu haben: die sachlichen Themen, die besprochen werden, und die Beziehungen der Sprechenden zueinander, die zwingend im Spiel sind und sich durch das Sprechen verändern. Damit haben wir einen handhabbaren Vorschlag, Kommunikation und psychische Systeme so miteinander zu verknüpfen, dass nicht Mord und Totschlag dabei herauskommen können, sondern, wie Ernst Bloch es hoffte: ein besseres Verständnis von Mensch zu Mensch.
August 2012
PublikationenSie möchten mehr über das Projekt erfahren? Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an!

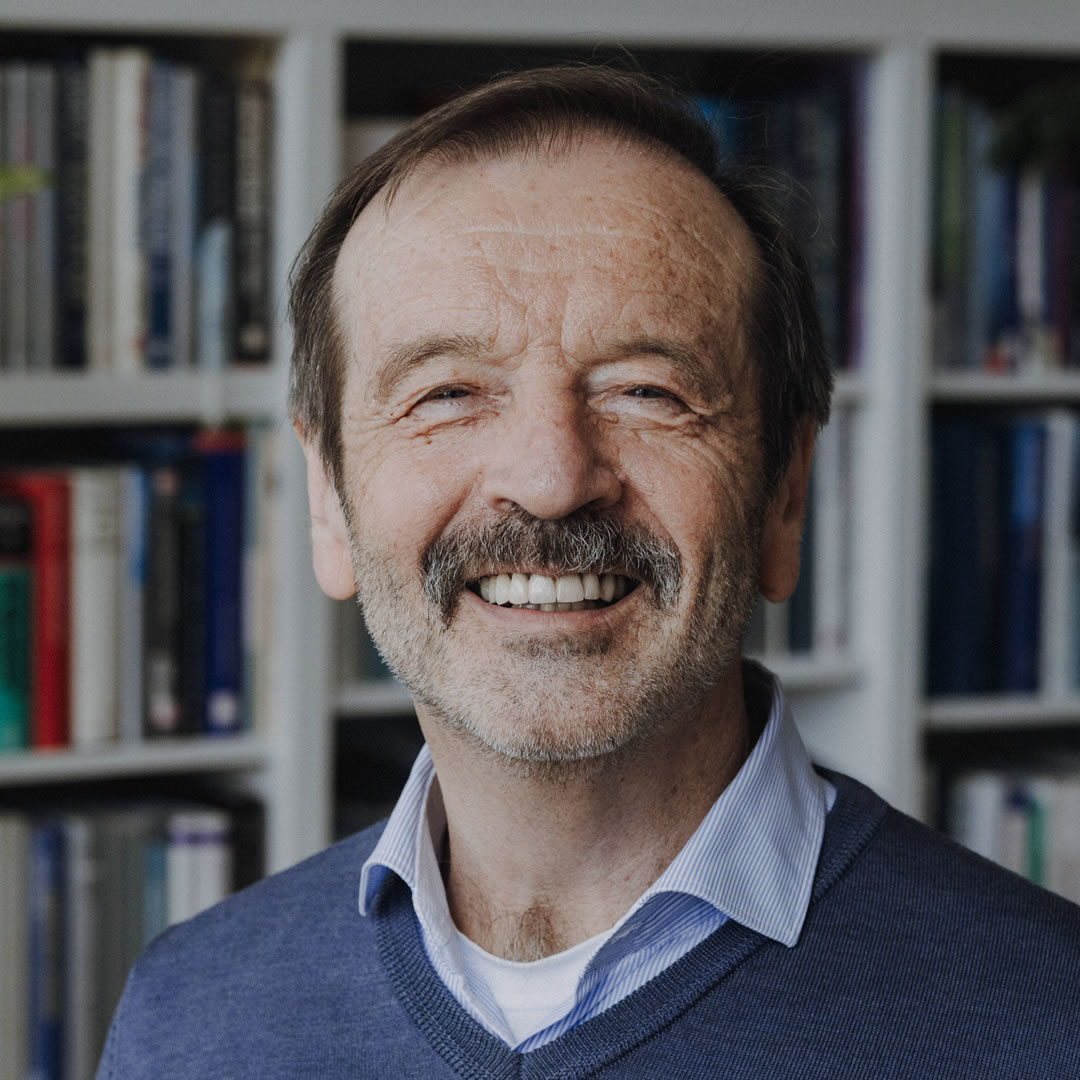 Karl-Heinz Schulz
Karl-Heinz Schulz








