04.04.25
Die Mandelkern-Kolumne / Folge 12
Die Sache mit dem Sinn
Er ist das Fluidum der Kommunikation schlechthin – und doch eine recht zwiespältige Angelegenheit.

In der Sinnfrage ist längst alles gesagt, nur noch nicht von allen. Für mich stellt sie sich so: Wenn es richtig ist, was Nietzsche sagte: „In der Realität fehlt der Zweck“, oder in den Worten eines heutigen Philosophen, Philipp Hübl: „Das Leben ist schön und sinnlos“, dann fragt sich: Wie kann es sein, dass in unserem Alltag Sinn allgegenwärtig ist, genauso wie sein Gegenteil natürlich, der Unsinn? Manche reden dieses Problem gerne klein. Schon Georg Büchner fand in seiner Doktorarbeit über das Zentralnervensystem der Barben, dieses erstaunliche Geschöpf trage seinen Sinn in sich selbst. Oder, in einem zauberhaften Epigramm aus dem späteren neunzehnten Jahrhundert:
Zu leben, das ist Kraft,
die voll sich selbst genügt,
ganz ohne sonst’gen Sinn,
allmächtig genug.
Es stammt von der amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson. Und der Anthropologe Joseph Campbell formulierte es so: „Die Leute sagen, dass wir alle nach einem Sinn des Lebens suchen. Ich glaube, was wir suchen, ist eine Erfahrung des Lebendig-seins, sodass unsere Lebenserfahrungen auf der rein physischen Ebene in unserem Innersten nachschwingen und wir die Lust, lebendig zu sein, tatsächlich empfinden.“ So sehr mich dieser Gedanke von Büchner, Dickinson, Campbell und vielen anderen auch beeindruckt, er überzeugt mich nicht. Für mich gehört zu den größten Freuden des Lebendigseins das Nachdenken. Und ob ich will oder nicht, die Unterscheidung von richtig und falsch nimmt dabei einen großen Raum ein. Namentlich, soweit es um Verhalten geht, ist das aber eng verwandt mit der Frage: sinnvoll oder nicht? Und da haben wir den Salat.
Wenn ich die Nietzsches, Hübls und vielen anderen dieser Sinn negierenden Richtung („Man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen.“) richtig verstehe, argumentieren sie so: Um einen Sinn – des Lebens und damit von allem anderen – ableiten zu können, müssten wir wissen, wozu das Universum gut ist. Wer will das sagen? Es ist sozusagen der deduktive Ansatz, und er greift erkennbar ins Leere. Dann gibt es diejenigen, die den umgekehrten Weg versuchen. Ihnen geht es wie mir. Sie stoßen überall auf Sinn und vertreten die Ansicht: Er muss irgendwoher kommen. Kühn gehen sie weiter und skalieren ihn gewissermaßen aufwärts. So schließen sie die Leerstelle, die bei der Frage nach dem Sinn des Universums für alle naturwissenschaftlich argumentierenden Menschen bleibt, mit der Antwort: Es muss jemand geben, der es weiß. Ob man diesen Jemand Gott nennt oder intelligent design - es läuft immer auf dieselbe Black Box hinaus. Auch der Verweis auf ‚Evolution‘ oder ‚Natur‘ bietet nicht wirklich mehr. Black Box heißt: Wir können den Sinn des Ganzen zwar nicht erkennen, aber darauf vertrauen, dass es einen gibt. Wer diesen induktiven Weg konsequent zu Ende geht, macht es wie die verschiedenen Religionsschöpfer: Sie wissen, nicht selten durch geltend gemachte göttliche Eingebung, wie der Hase läuft und leiten davon dann mehr oder weniger umfangreiche Glaubenslehren ab, Verhaltenslehren eingeschlossen (zehn Gebote, Koran etc). Gewöhnliche Sterbliche ringen vielleicht nicht mit Gott an der Himmelsleiter oder werden nicht wie Moses auf den Berg gerufen, aber sie glauben diesen Botschaftern Gottes. Kann man machen. Seit Kant wissen wir, dass sich die Existenz eines höheren Wesens weder beweisen noch widerlegen lässt. Das eröffnet in dieser Frage alle Freiheiten. Jeder darf glauben, was er will.
Philosophisch gesehen ist Kants Position agnostisch. Und auf die Sinnfrage angewendet heißt sie: Die Tatsache, dass wir keinen Sinn erkennen können, bedeutet nicht, dass es zwingend keinen gibt. Insofern bin ich anderer Meinung als Nietzsche, Hübl oder Camus. Und bin so klug als wie zuvor. Zurück auf Anfang: Wie kann es sein, dass wir auf der makroskopischen Ebene keinen Sinn erkennen können, auf der sozusagen mikroskopischen, als kleine Lichter im Universum, aber fortwährend? Man kann die Frage auch so formulieren: Wie kommt der Geist in die Natur? Die Antwort, die mich überzeugt, lautet: Gar nicht. Er ist schon immer darin. Womit wir aber wieder nur beim Ausgangspunkt sind. Um eine zurzeit populäre Version des Problems zu benutzen: Was war vor dem Urknall? Eine Frage, die zumindest nach Ansicht der sehr tiefgründig argumentierenden Physikerin Sabine Hossenfelder womöglich nie beantwortet werden kann.
So lässt sich auch die Überzeugung, dass das Universum auf geistigen Prinzipien aufgebaut ist, vermutlich nicht wirklich beweisen. Aber sie hilft nach meiner Erfahrung, ein sinnvolles, ethisch basiertes Leben zu führen.
3. April 2025
PublikationenSie möchten mehr über das Projekt erfahren? Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an!

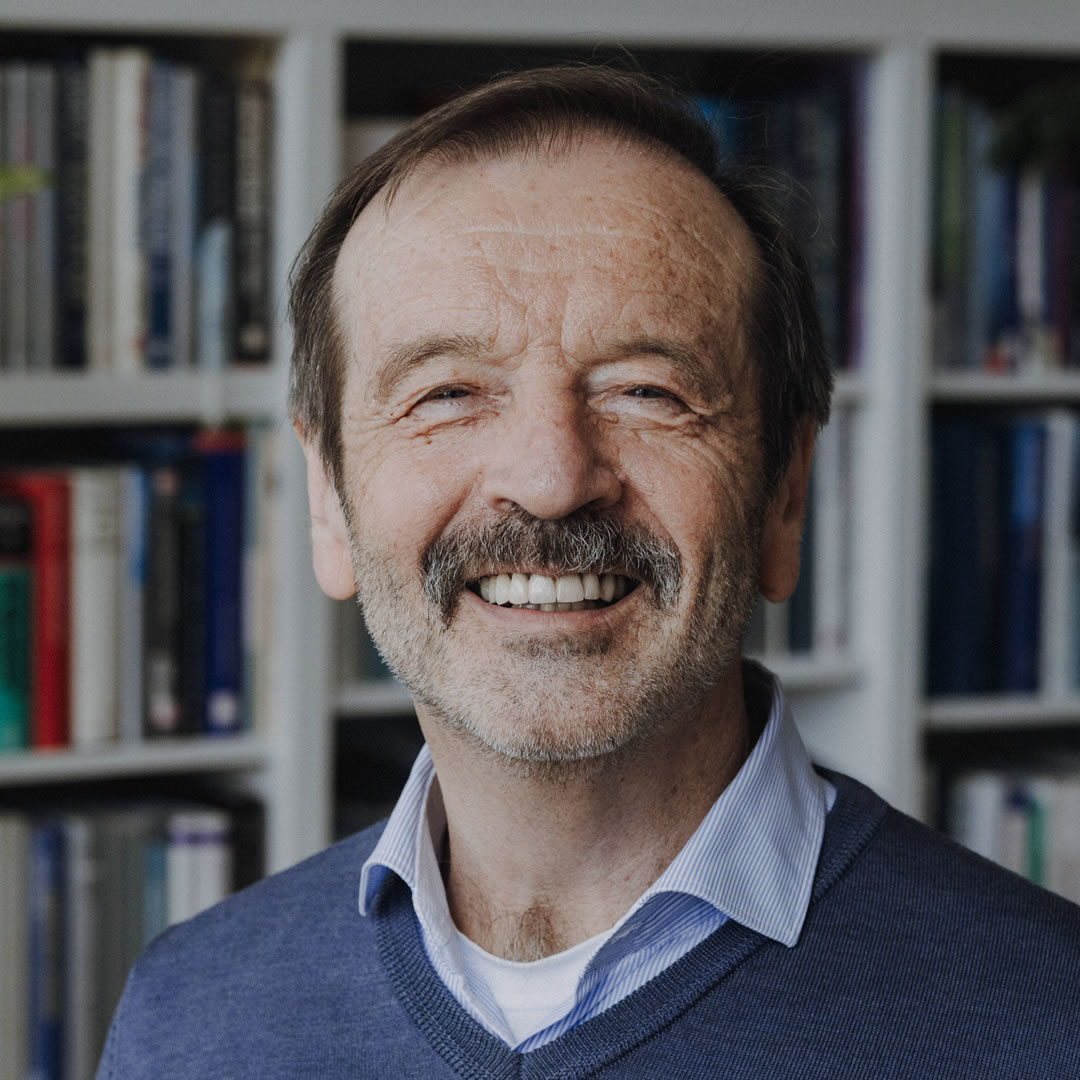 Karl-Heinz Schulz
Karl-Heinz Schulz








