03.07.25
Die Mandelkern-Kolumne / Folge 13
Vertrauen - Ein Lesebuch als Wundertüte
Ein Begriff, den man wie den berühmten Pudding an die Wand nageln kann. Walter Schwertl hat es versucht – mit Erfolg.

Mit dem Vertrauen verhält es sich ein wenig wie mit einem anderen Allerweltsbegriff: „Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich´s, will ich´s aber einem Fragenden erklären, weiß ich´s nicht.“ Das Eingeständnis stammt von dem großen Bekenner Augustinus, Bischof von Hippo. Würde man mich nach dem Vertrauen fragen, käme wohl etwas Ähnliches heraus. Auch Walter Schwertl, Autor eines erstaunlichen neuen Werks über dieses Phänomen, kommt schnell zur Sache: “Vertrauen ist ein deutlich unterdefinierter Begriff.“ Und man ahnt, wie er dies zu ändern gedenkt: mit viel Witz und Hintersinn. Doch zunächst einmal: Warum ist das, was wir alle so gut zu kennen glauben wie unsere Hosentasche, mit dem wir auf täglicher Basis hantieren, als sei es unser Lebenselixier, ein, wie Schwertl an anderer Stelle sagt, so „sperriges Konstrukt“? Nicht ohne in einer Fußnote zu erläutern: „Konstrukte sind theoretische Konzepte, die nicht direkt beobachtbar sind (z.B. Intelligenz).“ Hoppla, denkt der Leser, ich mag zwar nicht wissen, wie man Vertrauen definiert, aber wenn ich welches habe, merke ich das sehr wohl. Und exakt da liegt der Hase im Pfeffer: Jeder tut es, weiß aber nie sicher, ob er gut daran tut. Vertrauen, wie wir auch schon alle erfahren mussten, kann enttäuscht werden. Vertrauen geht nicht ohne Risiko. Und nun die Gretchenfrage: Wird das kleiner, wenn man das Buch gelesen hat? Natürlich kann der Rezensent nur für sich selber sprechen, aber mutig sagt er: „Ja“. Womit die unbedingte Leseempfehlung schon ausgesprochen wäre. Und jetzt? Was kann ich noch für Sie tun, lieber Leser? Gut, ich gebe zu, ein paar Gründe wären nicht schlecht. Sonst wäre die Vertrauensleistung, die ich Ihnen abverlange, wohl etwas sehr groß. Also dann, an die Arbeit.
Das Wichtigste zuerst: der Autor. Walter Schwertl blickt als promovierter Psychotherapeut auf eine lange, erfolgreiche Berufslaufbahn zurück. Als Mitbegründer der Familientherapie in Deutschland gehört er zu den führenden Praktikern der systemisch ausgerichteten Psychologie. Bei der umfangreichen Praxis – später kam eine langjährige Tätigkeit als Business-Coach dazu - beließ er es aber nicht. Vielmehr reflektierte er seine Arbeit in zahlreichen Publikationen, die sich tiefgründig mit Vordenkern der Systemtheorie wie Gregory Bateson, Niklas Luhmann und Siegfried J. Schmidt befassten. Heraus kam etwas, das Schwertl theoriegeleitete Praxis nennt. Für die Leser seiner Schriften hat dieser Anspruch den angenehmen Effekt, dass sie stets anschaulich, fakten- und beispielgesättigt, also gut lesbar daherkommen. Und doch sind sie etwas anderes als populärwissenschaftlich. Indem er die Konstrukte seiner Hausgötter, denen man auch persönlich in seinem Institut begegnen konnte, immer wieder der therapeutischen und beraterischen Erprobung aussetzte, entstand etwas Neues, ein systemischer Funkenflug, der einem so manches Licht aufsteckt. Und zwar auch dann, wenn man nicht als Klient die Essenz solcher Denkarbeit sozusagen eins zu eins erleben durfte. Und damit sind wir beim zweiten Grund: Das Buch stiftet Klarheit. Dass der Begriff Vertrauen deutlich unterdefiniert ist, wie der Autor sagt, mag erstaunen angesichts der Fülle von Ratgeberliteratur und Lebenshilfe-Kolumnen, die sich daran abarbeiten. Wissenschaftlich dagegen ist er erstaunlich wenig durchforscht, wie Schwertl aufzeigt. Und er benennt auch den Grund: „Vertrauen“, so sagt er, „ist eine Vorwegnahme der Zukunft“. Und die hat bekanntlich die Eigenschaft, prinzipiell unvorhersagbar zu sein. Das heißt auch: Sie ist kontingent. Das Unerwartete ist möglich. Mit diesem Midas-Gold der Moderne, wie Niklas Luhmann die Kontingenz nannte, handeln wir uns etwas ein, was Wissenschaftler überhaupt nicht mögen: Unbestimmbarkeit. „Wir operieren ohne Letztgewissheit“, sagt Schwertl, und das ist sein Milieu, in dem er als Berater wie als Autor zur Hochform aufläuft.
Wir erfahren, warum es nützlicher ist, von Grundvertrauen als von Urvertrauen zu sprechen und wie man daraus mit dem gerichteten Vertrauen eine praxistaugliche, operable Figur macht. Wir erfahren, warum Vertrauen und Kommunikation so etwas wie siamesische Zwillinge sind und warum sie mit dem Kontext eine Begriffs-Trias bilden, die in allen Lebenslagen von höchster Wirksamkeit sein kann. Zum Beispiel, wenn wir von Führung reden. Die Frage nach dem richtigen Führungsstil ist bekanntlich ein unerschöpflicher Quell marktgängiger Literatur, die in einer gut sortierten großstädtischen Buchhandlung schon einige Regalmeter füllen kann. Statt an der völlig unübersehbaren Fülle zu verzweifeln („soll ich lesen oder führen?“), seien einige Seiten Schwertl empfohlen: „Niemand entscheidet sich für einen Führungsstil, wie man sich für ein Theaterstück oder einen Film entscheidet. Im Gegenteil: Aufgaben, Herausforderungen und die umgebenden Kontexte suchen sich die passende Führung.“ Und damit sind die auf persönliche Veranlagung, Neigung oder Eignung abstellenden Ansätze, welche diese Literatur häufig speisen, an ihren Platz verwiesen: „Eine radikal andere Sichtweise bietet die Systemtheorie. Definiert man nämlich Unternehmen und Organisationen als Handlungs- und Kommunikationssysteme, können all die individualpsychologischen Forderungen zugunsten von Optimierung der Kommunikationsprozesse verschlankt werden.“ Diese Unterscheidung ist zentral für Schwertls systemtheoretischen Ansatz: Statt den Menschen in die Seele schauen zu wollen – „Kontingenz heißt ganz praktisch, man kann seinen Kommunikationspartnern nur bis zur Nasenspitze sehen“ – stellt er auf ihre Interaktionen ab, sprich, auf ihre Kommunikation. Denn „alles, was wirken soll“, zitiert er Luhmann hervorgehoben am Beginn seines Buches“, „muss durch das Nadelöhr der Kommunikation“. Heißt also: Wenn wir die Kommunikation verbessern, können wir leichter vertrauen? Genau das, und das Buch liefert eine Menge Tipps, wie man vertrauensfördernde Kommunikation entfalten kann. Mein liebster: „So tun, als ob.“
Trotzdem wachsen auch die Bäume des Vertrauens nicht in den Himmel. Die Welt wäre nicht so, wie sie ist, wenn es ganz so einfach wäre. Auch gut kommuniziertes Vertrauen hat seine Grenzen, und man kann schlicht auch zu viel vertrauen, wie Schwertl an einem unter die Haut gehenden Fallbeispiel aufzeigt. Also doch: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Erst einmal lernen wir, dass Lenin das so nie gesagt hat. Und vor allem lernen wir, dass Kontrolle nicht zwingend Misstrauen ist. Es ist erst einmal nur die Abwesenheit von Vertrauen, und bestimmte Kontrollsysteme (z.B. von Gepäck am Flughafen) haben unbestritten ihre Berechtigung. Wenn aber der Wunsch nach Kontrolle von Misstrauen gespeist wird, entstehen schnell toxische Kulturen. Unter der wunderbaren Überschrift „Misstrauen als Kulturprogramm“ handelt Schwertl das vor allem an Unternehmen ab. Und wenn Vertrauen – in Luhmanns berühmtem Diktum - ein großer Komplexitätsminderer sein kann, so zeigt Schwertl, wie Misstrauen als noch größerer Komplexitätsbeschleuniger wirkt – ein Gedanke, der in der aktuellen Debatte über Bürokratieabbau vielleicht noch stärker in Stellung gebracht werden könnte.
Aber die Systeme von Politik, Medien und Justiz lässt der Autor bewusst außen vor, weil es, wie er schreibt, dafür noch ein eigenes Buch gebraucht hätte. Die übrigen sozialen Systeme, vor allem Unternehmen, Familien und Paare, bieten Stoff genug. Und damit sind wir bei meinem dritten und letzten Grund: den Fallgeschichten. Sie sind nicht nur fesselnd geschrieben - man merkt den Romancier, der Schwertl auch noch ist – sondern hoch instruktiv. Wir lernen z.B., warum er lieber von Paarberatung als von Paartherapie spricht und worin er das Erfolgsgeheimnis der systemischen Familientherapie sieht: weil sie statt mit Tools mit Fragen arbeitet. Überhaupt die Fragen: mehrere Seiten widmet er dem Thema, wie man gute Fragen stellen lernt (Sokrates lässt grüßen). Und sie, die Praxisbeispiele, bereichern die ganze Fülle des Buches mit seinen vielfältigen Themen – allein das Kapitel über Netzwerke lohnt schon den Kauf des Buches – durch ihre Anschaulichkeit und tragen das ihre dazu bei, dass dieses Buch noch mehr ist als ein Lesebuch: die reinste Wundertüte. Nur, dass die Fundsachen alle wertig sind. Diesem Autor können Sie vertrauen.
Vertrauen in Sozialen Systemen – Gefahr oder Chance? Ein Lesebuch für Coaching, Beratung und Therapie, Vandenhoeck & Ruprecht ISBN 978-3-525-40875-9
PublikationenSie möchten mehr über das Projekt erfahren? Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an!

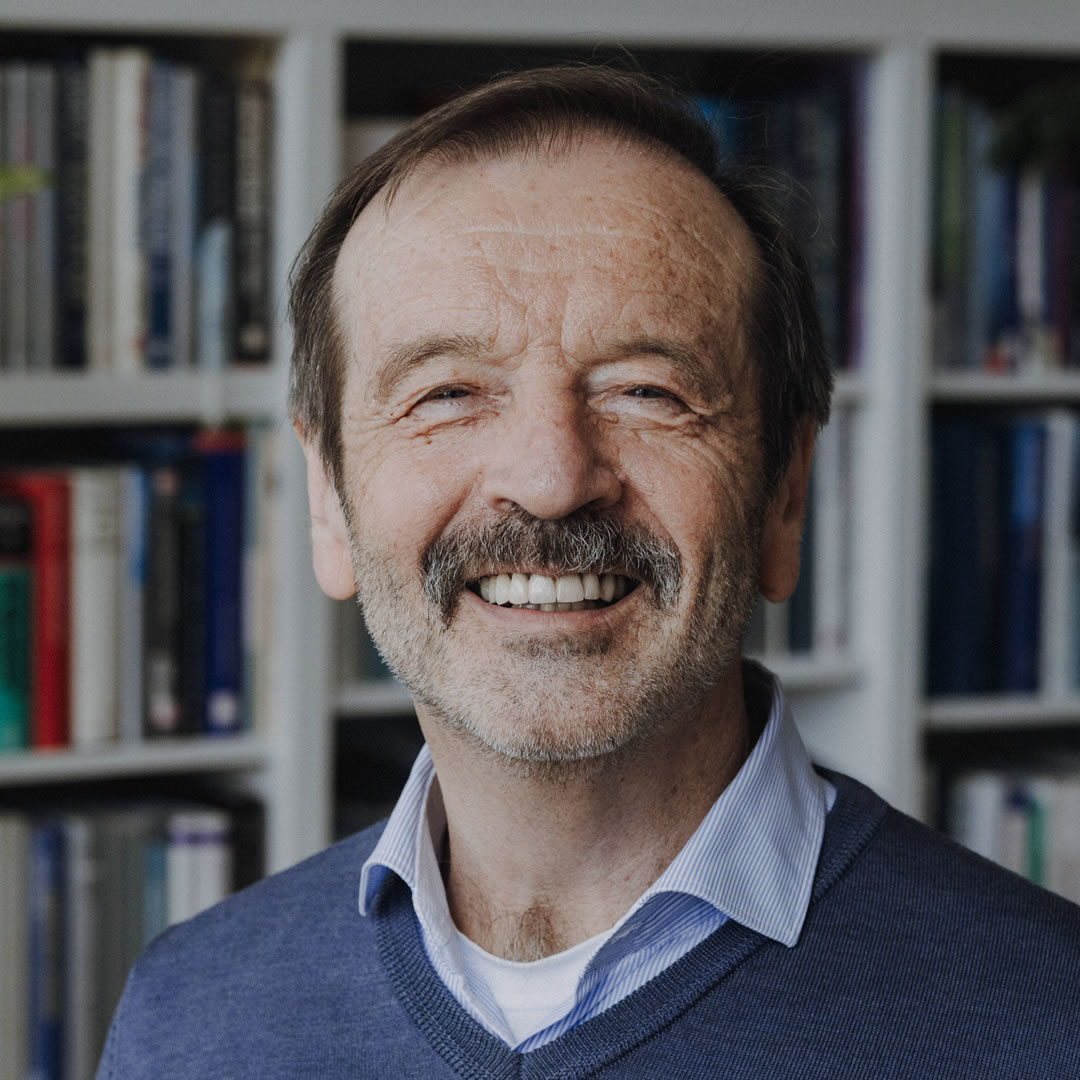 Karl-Heinz Schulz
Karl-Heinz Schulz








